Internationaler Tag der Frau am 8. März 2019
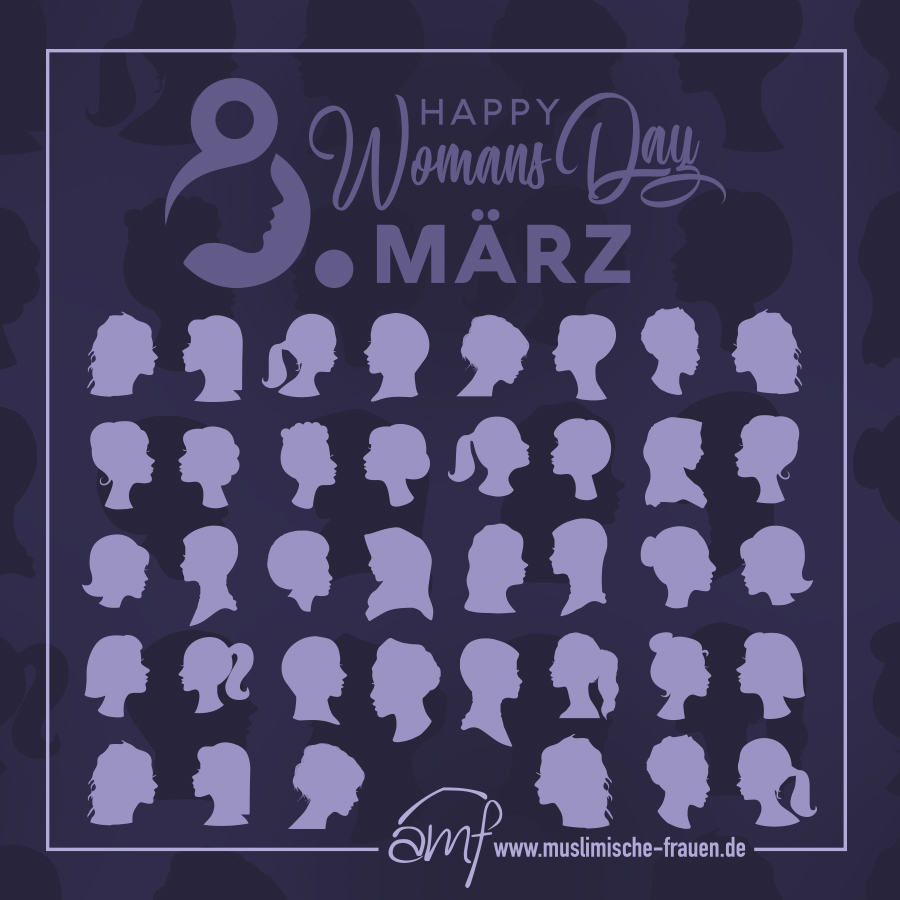
Jahrestage sind prädestiniert dafür, einen Blick in die Vergangenheit und einen in die Zukunft zu werfen.
Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Frauen schon sehr lange für ihre Rechte kämpfen müssen und sich manche Dinge, insbesondere Strukturen und Denkweisen, nur sehr langsam verändern. In der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart wurde und wird einigen Frauen eine gesetzlich verordnete Rolle rückwärts zugemutet, und das scheint sich in naher Zukunft nicht zu ändern, im Gegenteil.
Doch der Reihe nach: 1910 forderte Klara Zetkin auf einem Kongress mit Blick auf die Frauen schlicht und ergreifend: „Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte“; 1911 gingen Frauen in Deutschland und einigen anderen Ländern mit der Forderung nach mehr politischer Teilhabe auf die Straße, 1919 schließlich durften Frauen in Deutschland wählen und 1921 legte man sich auf den 8. März als Internationalen Frauentag fest.
1910, 1911, 1919, 1921 – wie sich das anhört! Nicht einmal unsere Eltern waren damals geboren, bei vielen von uns nicht einmal die Großeltern.
Seitdem hat sich – zwar langsam, aber immerhin – einiges getan. Die Autonomie von Frauen wurde gestärkt, indem sie selbst darüber entscheiden konnten, ob sie berufstätig sein wollten. Ihr Schutz vor Gewalt wurde nach und nach verbessert, zuletzt auch innerhalb der Ehe. Rechtliche und gesellschaftliche Hürden beim Zugang zu für Frauen „untypischen“ Berufen wurden im Namen der Gleichstellung nach und nach beseitigt. Theoretisch können heute alle Frauen in dem Beruf arbeiten, zu dem es sie hinzieht und für den sie sich qualifiziert haben. „Nur die Qualifikation zählt!“, also weder Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion oder sonstige Merkmale, die das AGG (aus gutem Grund) aufzählt – so jedenfalls lautet das Versprechen und das Glaubensbekenntnis unserer modernen und aufgeklärten Gesellschaft. Keine Firma, keine Behörde würde von sich behaupten, dass nicht genau dies das Prinzip der eigenen Unternehmenskultur sei.
Soweit die Theorie.
Ein Blick in die Praxis zeigt, dass nach wie vor von einer gleichen Teilhabe Aller nicht die Rede sein kann: Je hierarchisch höher oder prestigeträchtiger ein Beruf oder ein Amt ist, desto seltener bildet sich dort die gesellschaftliche Vielfalt ab. Das gilt nicht nur in Bezug auf die Geschlechtszugehörigkeit, aber auch, und darum soll es mit Blick auf den 8. März vorrangig gehen.
Während für die Mehrheit der Frauen sukzessiv immer mehr Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt fielen und noch existierende Hürden kritisch diskutiert wurden und werden, wurden sie für Frauen, die ein Kopftuch tragen, immer wieder explizit geschaffen. Sobald sie in angesehenen Berufen sichtbar wurden, begann die politische Debatte, die mit gesetzlichen Verboten endete: Lehrerinnen, Erzieherinnen, Beamtinnen, uniformierte Dienste und nun seit einiger Zeit der Justizdienst. Die renommierte Psychologin und Feministin Birgit Rommelspacher analysierte dies schon vor vielen Jahren messerscharf und stellte fest: Solche Ausgrenzungsphänomene sind symptomatisch für die Phase einer Gesellschaft, in der sich die Multikulturalität nicht mehr leugnen lässt und die Neu-Bürger*innen Partizipationschancen einfordern bzw. offensichtlich wird, dass sie sie bereits wahrnehmen. Die Ursache der Ausgrenzungsversuche sind ihren Untersuchungen zufolge auf Verteilungskonflikte zurückzuführen, den Anspruch der „Neuen“ auf Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen, zu Bildung, auf politischen Einfluss und öffentliche Repräsentanz. Der Mechanismus, diese Ansprüche abzuwehren, folgt einem altbewährten Prinzip, mit dem sich eine Gesellschaft in „wir“ und „ihr“ teilen lässt. Ohne Zutun und Einflussmöglichkeit der Betroffenen wurde das Kopftuch kurzerhand zum „Symbol“ erklärt, das sich mit den Werten der Verfassung nicht vertrage. Daher signalisiere jede Kopftuchträgerin mit dem Festhalten an ihrer Kopfbedeckung, dass sie „fremd“ sei, nicht die gleichen Werte teile, nicht in die Gesellschaft passe. Mit diesem „Othering“ – quasi der Zuschreibung der Nicht-Zugehörigkeit – lässt sich berechtigten Ansprüchen, wie z.B. die Freiheit der Berufswahl, die Legitimität entziehen. Gleichzeitig kann das eigene positive Selbstbild als aufgeschlossener und toleranter Mensch, als Befürworter der individuellen Freiheit, aufrechterhalten werden, denn aus dieser Perspektive hat sich die Kopftuchträgerin selbst ins Abseits manövriert, nicht etwa die (oft politisch motivierten) Zuschreibungen. Mit der vorgeblich neutralen Feststellung von kultureller Unterschiedlichkeit werden zudem rechtliche Konsequenzen (Kopftuchverbote) legitimiert, die wiederum die existierenden sozialen Hierarchien aufrechterhalten.
Gern wird dabei ignoriert, dass ein Kopftuchverbot eine starke geschlechtsspezifische Komponente hat, denn es trifft ausschließlich Frauen; muslimische Männer sind davon nicht beeinträchtigt. Folgerichtig stellte das Bundesverfassungsgericht 2015 fest, dass Kopftuchverbote im Konflikt mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes stehen und ausgerechnet gut ausgebildete Musliminnen an einer qualifizierten Berufstätigkeit hindern.
Frauen, die zum Kopftuchtragen gezwungen werden, hilft ein Verbot nicht; dort sind andere Maßnahmen gefragt, wie z.B. eine niedrigschwellige Beratung und Unterstützung. Ein Verbot dagegen ist kontraproduktiv, denn es versperrt betroffenen Frauen den von der Emanzipationsbewegung hart erstrittenen, klassischen Weg zur Selbstermächtigung: die Ergreifung eines Berufs, der sie wirtschaftlich unabhängig macht und die Grundlage dafür ist, sich selbst aus einer repressiven Beziehung lösen zu können.
Grundsätzlich bedarf es keiner (weißen) Männer und Frauen, um kopftuchtragende muslimische Frauen zu „befreien“, es braucht den Abbau von Ausgrenzungsmechanismen und tatsächliche Chancengleichheit. Denn: Der Zwang, gegen den eigenen Willen ein Kopftuch tragen zu müssen, steht dem Zwang, es gegen den eigenen Willen ablegen zu müssen, in nichts nach.
Es ist an der Zeit einzusehen, dass die Erkenntnisse der Frauenbewegung für alle Frauen, ungeachtet ihrer Religion, Weltanschauung oder Herkunft gelten. Einer dieser Meilensteine war, die individuelle Freiheit in den Vordergrund zu stellen und Argumente, die mit „Jede Frau…“ begannen, als das zu entlarven, was sie sind: Stereotype, die die eigene Weltsicht zum alleinigen Maßstab erheben. Darum ist die Erinnerung an die Erkenntnis der zweiten Frauenbewegung: „Keine Frau ist jede Frau“ nach wie vor aktuell – die Vorstellungen von einem Leben, das Frau zufriedenstellt, sind so vielfältig, wie die Frauen selbst und die Wege, die dorthin führen. Das gilt auch für muslimische Frauen mit und ohne Kopftuch.
